Hohenstein (Nassau) | Epoche IV
Als Nächstes stelle ich den Gleisplan für die Epoche IV vor, wie sich dieser in der Zeit von Ende 1974 bis 1986 dem Betrachter zeigte. Beim Erstellen des Gleisplans wurde darauf geachtet, dass die Radien stimmen und die Weichen dem Vorbild weitgehend entsprechen. Ansonsten ist kompletter Weichenselbstbau für denjenigen angesagt, der es partout vorbildlich und „pur“ haben möchte.
Betriebsdaten Personen- und Güterverkehr - letzte planmäßige Fahrt am Vortag
25.09.1983 - Stillegung zwischen Wiesbaden-Waldstraße und Bad Schwalbach
27.09.1986 - Einstellung Personenverkehr zwischen Bad Schwalbach und Diez
28.12.1989 - Einstellung Güterverkehr zwischen Bad Schwalbach und Kettenbach
01.12.1990 - Einstellung Güterverkehr zwischen Hohenstein und Kettenbach
01.06.1999 - Einstellung Güterverkehr zwischen Kettenbach und Diez
Aktueller Gleisplan - eingestellt am 17.12.202
Station Hohenstein 1974 - bis zur Einstellung a) des Personenzugverkehrs am 27.9.1986 und b) des Güterverkehrs am 1.12.1990

Anlagen-Steckbrief Hohenstein Epoche IV 1974-1982 • Nenngröße H0 • MiniMax-Module
Gleismaterial: Weinert „Mein Gleis“ Code 75
Dieselloks: BR 211, BR 212, BR 216
Akku-Triebwagen ab 1980: BR 517/BR 817 von KATO, BR 515/BR 815 von KATO oder ROCO
Triebwagen: BR 798/998
n-Wagen: Nahverkehrswagen, Steuerwagen Hasenkasten oder Karlsruher Kopf von PIKO
Personenwagen: Umbauwagen 4-achsig - ROCO 44029 und 44030 (Heimatbahnhof Wiesbaden)
Güterwagen: G 10, G 20, Omm55, Eaos, Kbs 442 - ab 1983 überwiegend Snps 719 (Forstwirtschaft)
5. Dezember 2022
Am vergangenen Wochenende habe ich auf einer Börse ein wichtiges Buch über die Aartalbahn mit vielen Fotos für mein Archiv erstanden. Das Buch aus der Reihe SCHIENE-Photo Band 2 von Joachim Seyferth mit dem Titel «Die Aartalbahn» enthält viel bildliche Informationen, die im «Netz» so nicht zu finden sind. Allein die Tatsache, dass noch Dampfloks wie die 051 920 und 052 167 bis Ende 1973 eingesetzt wurden, war Grund genug, den Gleisplan zu revidieren. Außerdem zeigt das Foto auf Seite 16, dass das dritte Gleis (Güter-/Ladegleis) am 7. Juli 1973 noch nicht rückgebaut war und dass wahrscheinlich auch noch der Güterschuppen stand. Man kann also davon ausgehen, dass bis Mitte 1974 auch noch alle notwendigen Weichen vorhanden waren und genutzt wurden.
Diese betriebliche Situation ist für mich Grund genug, den Gleisplan als zeitlich Variante an die Betriebsjahre 1968-1974 anzupassen, welche für einen vorbildgerechten Modellbahnbetrieb interessant sein dürfte. Auch interessant ist, dass der Gleisanschluss zum Klinkerwerk zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr bestand, wie ich in einem Gespräch mit einem Streckenkenner erfuhr.
Any way - zur Station Hohenstein habe ich schon vieles vorgestellt und komme nun zum Gleisplan für die Betriebsjahre 1968-1974.
Aktueller Gleisplan - eingestellt am 17.12.202
Haltestelle Hohenstein Epoche IV 1968-1974

Anlagen-Steckbrief Hohenstein Epoche IV 1968-1974 • Nenngröße H0 • MiniMax-Module
Gleismaterial: Weinert „Mein Gleis“ Code 75
Dampfloks bis 1974: 065 001, 065 014, 065 018, 050 638, 051 920 und 052 167
Dieselloks: BR 211, BR 212, BR 216
Triebwagen: BR 798/998
n-Wagen: Nahverkehrswagen, Steuerwagen Hasenkasten oder Karlsruher Kopf von PIKO
Personenwagen: Umbauwagen 4-achsig - ROCO 44029 und 44030 (Heimatbahnhof Wiesbaden)
Güterwagen: Omm55, Eaos
Breithardt | Epoche IV
Während der Planung, die bereits bestehenden Streckenabschnitte Diez-Zollhaus und Langenschwalbach-Wiesbaden durch den Bau der Aartalbahn Zollhaus-Langenschwalbach zu verbinden, um einen durchgehenden Verkehr von Diez nach Wiesbaden zu ermöglichen, wurden in Breithardt Stimmen laut, die vehement einen Haltepunkt forderten. Nach vielen Verhandlungen konnten sich die Breithardter Bürger durchsetzen und bekamen ihren Haltepunkt und damit Anschluss an die weite Welt.
Neben den anderen einfachen Haltepunkten der Aartalbahn ist Breithardt für den Eisenbahnmodellbauer wohl der interessanteste und habe beim Planen große Sorgfalt walten lassen, möchte aber dennoch ein paar Hinweise zu der vorgestellten Epoche geben.
In der Epoche IV waren die Halte- und Preiftafeln in Richtung Hohenstein direkt an den beiden letzten Lampenmasten befestigt (bei der Bushaltestelle) und nicht wie sonst üblich auf eigenen Pfosten. Nur in der Epoche I standen diese Tafeln auf eigenen Pfosten und der Bahnübergang wurde durch den Zugführer gesichert und wahrscheinlich stand am Straßenübergang auch ein Läutewerk, bin mir aber nicht sicher. Ansonsten gehe ich davon aus, dass meine bisherigen Recherchen richtig waren und der Gleisplan den ehemaligen Gegebenheiten am Haltepunkt Breithardt der Epoche IV entspricht.
Gleisplan Haltestelle Breithardt Epoche IV > derzeit nicht aktuell (17.12.2025)
Anlagen-Steckbrief Hohenstein-Breithardt Epoche IV 1970-1990 • Nenngröße H0 • MiniMax-Module
Gleismaterial: Weinert „Mein Gleis“ Code 75 oder Roco Line ohne Bettung
Dampfloks bis 1973: 065 001, 065 014, 065 018, 050 638, 051 920 und 052 167
Dieselloks: BR 211, BR 212, BR 216
Akku-Triebwagen ab 1980 bis 1983: BR 517/BR 817 von KATO, BR 515/BR 815 von KATO oder ROCO
Triebwagen: BR 798/998
n-Wagen: Nahverkehrswagen, Steuerwagen Hasenkasten oder Karlsruher Kopf von PIKO
Personenwagen: Umbauwagen 4-achsig - ROCO 44029 und 44030 (Heimatbahnhof Wiesbaden)
Güterwagen: Omm55, Eaos
Der Plan zeigt alle bahntechnischen Einrichtungen wie Warnblinkanlage und Bü 0/1 mit
Überwachungssignalwiederholer (ÜSW). Da es sich um einen Signalwiederholer mit weißumrandeter schwarzer quadratischer Scheibe mit weißem Kreis handelt, stand am Anfang der Einschaltstrecke ein Bü-Signal in 240 Meter Entfernung plus Abstand Höchstgeschwindigkeit x 2 eine Rautentafel (
Bü2 - siehe auch Link). Zum besseren Verständnis ein Beispiel: 240 Meter plus Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h x 2 gleich gesamt 360 Meter. Somit liegt der Einschaltpunkt bei 360 Meter, welcher durch eine
Rautentafel gekennzeichnet wird.
Diese Abbildung stellt die Situation an der Haltstelle Breithardt am besten dar.
Entgegen einem Baubericht über den Haltepunkt Breithardt in der MIBA Spezial 78, wo im Gleisplan lediglich nur 4 Blinkanlagen eingezeichnet sind, befanden sich am Bahnübergang aber tatsächlich
6 Warnblinker (im Link dritte Abbildung). Bei der Breite der Bundesstraße habe ich die vorgeschriebene Breite von 7,5 Meter plus beidseitig je 1,5 Meter Bankett angewandt.
Signal Bü 0/1 wie dieses in Breithardt stand.
Zeichnung: Horst Wilhelm Bauer
Das DB Schalthaus stand im Abstand von 6 Metern (ab Rückseite gemessen!)
zur Straße am Haltepunkt Breithardt.
Zeichnung Maßstab 1:32: Horst Wilhelm Bauer
Eiserne Hand | Epoche I
Ein dankbares Anlagethema ist die Station „Eiserne Hand“ zur Länderbahnzeit, da sich alles auf einer Länge von 4 Meter als Modulanlage vorbildentsprechend umsetzen lässt. Obwohl diese Station ursprünglich nur als Haltepunkt für Förster und Waldarbeiter geplant war, entwickelte sich die „Eiserne Hand“ sehr schnell zu einem beliebten Ausflugsziel und wurde dadurch entgegen den Planungen der KED Frankfurt zu einer Station zum Kreuzen von Zügen mit ausgedehnten Gleisanlagen, die mittels Formsignale bis in die Epoche III gesichert wurden.
Eine weitere Besonderheit dieser Station ist die Tatsache, dass Züge aus Wiesbaden kommend aufgrund der erheblichen Steigung von 1:30 (33,3‰) nachgeschoben wurden mussten und die Schublok erst bei Kilometer 13,9 das Nachschieben einstellte, um danach als Lz in ihren Heimatbahnhof zurückzukehren. Bis zum Neubau des Bahnhofs Wiesbaden durch die ED Mainz und seiner Eröffnung am 15. November 1906 war das der
Rheinbahnhof.
Rekonstruktion Gleisplan Station „Eiserne Hand“ Epoche I > derzeit nicht aktuell (17.12.2025)
 |
|
Anlagen-Steckbrief Eiserne Hand Epoche I 1898 • Nenngröße H0 • MiniMax-Module
Gleismaterial: Weinert „Mein Gleis“ Code 75
Dampfloks: T 3, T 9.3 von Liliput und T10 von Fleischmann
Akku-Triebwagen: ETA 178 (Liliput)
Personenwagen: Langenschwalbacher von Liliput (811, 812)
Güterwagen: Omk, R10, G 02, G10
Hoheitszeichen: K.P.u.G.H.St.E. ED Mainz ab 01.04.1897
Grundlage für den gezeigten Gleisplan war neben anderen alten Ansichtskarten eine weitere Ansichtskarte aus meiner Sammlung, welche die Ausführung des Stationsgebäudes „Eiserne Hand“ um 1895 zeigt. Im Vordergrund der AK erkennt man ein Feldbahngleis, welches wohl der Forstwirtschaft als Zubringer zum Ladegleis diente (im Gleisplan rechts).
Einen Gleisplan für die Epoche IV schenke ich mir, denn zurückgebaut auf ein einziges Gleis strotzt die Station Eiserne Hand vor Langweiligkeit in hohem Maße.
Umgelaufene Ansichtskarte aus dem Jahr 1895 von der Station Eiserne Hand
Ansichtskarte: Sammlung Horst Wilhelm Bauer
Diese Ansichtskarte aus dem Jahr 1930 zeigt die voll ausgebaute
Station Eiserne Hand mit regem Andrang zur Gastronomie
Ansichtskarte Echt-Foto - ungelaufen: Sammlung Horst Wilhelm Bauer
Chausseehaus | Epoche IV
Die Station Chausseehaus hat ihren ganz eigenen Charme und lässt sich auf rund 5 Meter Länge auf MiniMax-Modulen problemlos realisieren. Die Rekonstruktion der Gleisanlagen erfolgte auf Basis eines Gleisplans von 1926 und einem Foto vom 18. Juni 1967, als der Rückbau begann, und wurde für das Gleissystem von Weinert «Mein Gleis» mit 1:9 Weichen angelegt.
Bevor ich meinen finalen Gleisplan vorstelle, zeige ich Repros von zwei alten Ansichtskarten aus meinem Archiv, wobei das Empfangsgebäude im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört worden ist und nicht mehr aufgebaut wurde. Und wenn mich einmal der Teufel reiten sollte, zeichne ich auch noch den Gleisplan von 1926 ins Reine, damit die Länder- und Reichsbahner etwas Konkretes zum Nachbauen haben.
Diese Ansichtskarte zeigt die Station Chausseehaus um 1899
Ansichtskarte Echt-Foto - ungelaufen: Sammlung Horst Wilhelm Bauer
Einfahrt in die Station Chausseehaus aus Richtung Eiserne Hand
mit Blick auf das Erholungsheim Taunusblick
Ansichtskarte (1900): Sammlung Horst Wilhelm Bauer
Finaler Gleisplan Station Chausseehaus 1965-1967 • Epoche IV 1965-1990 nach NEM 806 D > derzeit nicht aktuell (17.12.2025)
Anlagen-Steckbrief Chausseehaus 1965-1967 • Epoche IV 1965-1990 nach NEM 806 D • Nenngröße H0 • MiniMax-Module
Gleismaterial: Weinert «Mein Gleis»
Dampfloks: BR 051, BR 052, BR 065
Dieselloks: BR 211, BR 212, BR 216, BR 260
Personenwagen: Umbauwagen 4-achsig Epoche IV oxidgrün - ROCO 44029 und 44030 (Heimatbahnhof Wiesbaden)
Güterwagen: Omm53, Omm55, R10, G10
Wiesbaden-Dotzheim | Niemand hat die Absicht, eine Anlage zu errichten!
Auf der Suche nach einem Bahnhof, der es aufgrund seiner Lage und Ausdehnung ermöglichen würde, alles auf rechtwinkligen Modulen bei ebenen Gelände bauen zu können, bot sich völlig unerwartet der Bahnhof Wiesbaden-Dotzheim an. Wenn man die betrieblichen Möglichkeiten und das Angebot an Modellfahrzeugen ins Auge fasst, sieht alles wunderbar aus, außerdem hat Dotzheim ein Stellwerk mit Fahrdienstleiter, einen doppelt beschrankten Bahnübergang, einflügelige Ausfahrsignale sowie ein ungekoppeltes Einfahrsignal nahe der Brücke über die Flachstraße bei Kilometer 6.58. Ein weiteres ungekoppeltes Einfahrsignal aus Richtung Bahnhof Waldstraße bei Kilometer 5,6 wird im Modell nur dann benötigt, wenn man diese Situation darstellen möchte.
Der Bahnhof Hahn-Wehen wäre eine Alternative gewesen, allerdings sind nicht nur die Hochbauten alleine unansehnlich, jedenfalls für mich, sondern auch das ganze Drumherum und Bad Schwalbach scheidet ob seiner ausgedehnten Gleisanlagen vollkommen aus ebenso wie Zollhaus aufgrund seiner Länge, obwohl Zollhaus einiges zu bieten hätte.
Diese epochale Variante soll u. a. die Möglichkeit bieten Akku-Triebwagen von Roco und KATO dem Vorbild entsprechend einsetzen zu können, wie es u. a. das Foto von Karl-Hans Fischer mit dem 517 007 vom 01.09.1971 zeigt (
eisenbahnsignale-de). Außerdem kann man auch die maßstäblich langen Nahverkehrswagen mit Steuerwagen (Karlsruher Kopf und „Hasenkasten“) ins Spiel bringen, gezogen von einer ozeanblaubeigen (o/b) oder altroten (r) BR 216 mit den Betriebsnummern 216 130-5 (o/b), 216 135-4 (o/b) und 216 137-0 (r), nachdem die Modelle mittels Decals die korrekte Nummerung, Bahndirektion nebst BW erhalten haben; die 216 135 war übrigens bis 1974 altrot lackiert.
Auch bei denen im Handel erhältlichen Modelldampfloks müsste man Hand angelegen, um die Loks korrekt für die Aartalbahn umzuzeichnen. Das einzige Dampflokmodell mit der richtigen Betriebsnummer und Beschriftung ist die BR 065 001 von Trix mit der Artikelnummer 22664.
Bei den Triebwagen BR 517/817 von Kato (73328 und 73327) stimmt alles bis auf die Zuglaufschilder, was aber kein großes Problem ist, diese mittels Decals abzuändern. Lediglich die Modelle BR 515/815 von Kato und Roco müssen komplett umgezeichnet werden, wobei der Akku-Triebwagen BR 515 535 mit Steuerwagen 815 674, Artikelnummer
Roco 72081, unverändert für die Aartalbahn einsatzbar ist, weil er die korrekte Beschriftung BD Frankfurt/M, BW Worms, AW Limburg aufweist.
Maß nehmen
Jetzt gilt es, alle Gebäude zu vermessen und einige Punkte wie z. B. Gleisabstände noch einmal nachzuprüfen. Da alles vor meiner Haustür liegt, ist es für mich kein großer Umstand, das nahe gelegene Objekt aufzusuchen und werde im Anschluss daran im
Café Gude Kaffee und Kuchen genießen.
Aartalbahn | Literatur
Diese Bücher sollten bei einem Aartalbahnbegeisterten Modelleisenbahner auf keinen Fall fehlen. Mit etwas Glück kann man diese im Netz noch ergattern, besonders wichtig ist das Büchlein von Norbert Eifler über die Langenschwalbacher Wagen mit vielen Zeichnungen.
Bei den Büchern von Klaus Kopp erfährt der Leser vieles über die Aartalbahn von den Anfängen bis hin zur NTB (Nassauische Touristik-Bahn) redaktionell gestützt mit vielen Fotos über alle Epochen hinweg sowie Gleisskizzen von Bad Schwalbach, Hahn-Wehen, Hohenstein und Dotzheim aus den Zeiträumen von 1948 bis 1958.
Das Buch «Die Aartalbahn» von Joachim Seyferth ist ein reiner Fotoband mit Abbildungen hauptsächlich aus den Jahren 1958 bis 1990, wobei der Zeitraum 1980 bis 1984 mit den Triebwagen BR 515 und BR 517 (Limburger Zigarre) den Schwerpunkt bilden. Alles in allem ein schöner Bildband.
Themenbezogene Bücher aus meinem Archiv
Recherchen - Rekonstruktionen - Fotos - Zeichnungen - Illustrationen - Modellbau: Horst Wilhelm Bauer
© Horst Wilhelm Bauer • Alle Rechte vorbehalten
Stand: 17. Dezember 2025
















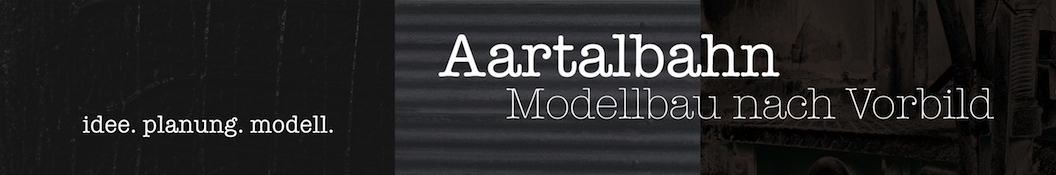












Kommentare